Paludikultur-Newsletter 2|2024
For the English version of our Newsletter please click here.
Moor und Klima - allgemein
Unterschätzte und bedrohte Moore im Brasilianischen Cerrado

Brasilien ist riesig, aber die Community der Moorforschenden klein. Felix Beer, Doktorand an der Universität Greifswald, hat Verteilung und Zustand der Moore in zentralbrasilianischen Cerrado erfasst. Hier sein Erfahrungsbericht aus einem Gebiet sieben mal so groß wie Deutschland.

Die Sonne brennt von oben, die staubige Luft flimmert über knorrigen, gedrängten Büschen und Bäumen. Der rote, sandige Boden ist nur spärlich mit Gräsern bedeckt. Eigentlich würde man in der zumeist trockenen, heißen Savannenregion Cerrado in Zentralbrasilien keine Moore erwarten. Dann aber lichtet sich plötzlich die Landschaft und die Erde wird feucht und schwarz. Seggen, Grasbulte und kleine Sträucher ziehen sich weit entlang eines flachen Tales und sind ab und zu gespickt mit Buriti-Palmen (Mauritia flexuosa), die bis zu 20 Meter in den blauen Himmel ragen. In der Talmitte längs eines Bachs sind die Buritis aufgereiht wie an einer Perlenschnur. Gleich am Rand, wo wir mit den Schuhen bereits einsinken, aber noch keine nassen Füße bekommen, testen wir mit einer Klappsonde die Mächtigkeit des organischen Bodens und nehmen erste Proben um den Kohlenstoffgehalt später im Labor zu bestimmen. Zwei Stunden und drei Bohrlöcher später stehen wir mit nassen Beinen bis zur Hüfte und total verschwitzt in der Mitte des Moores auf 3,5 Meter Torf und sind überrascht und glücklich. Unser Team, Cássia Munhoz, Professorin für Botanik an der Universität Brasília, zwei ihrer Studierenden und ich, ist gerade dabei das erste Mal überhaupt systematisch Moore im Cerrado zu kartieren, um Verbreitung, Torfmächtigkeit und gespeicherte Kohlenstoffmengen festzustellen. Und wir finden Moore eigentlich überall entlang der feuchten Täler in einer Art Mosaik mit anderen Feuchtgebieten und viel häufiger als wir es selbst erwartet hätten. Veredas werden diese Palmsavannen-Formationen, die auf den dauernassen Standorten entlang flacher Täler vorkommen, im Cerrado genannt.
Der Cerrado wird von einem dichten Netz von Flusstälern durchzogen, die diese riesige Region, die sieben Mal so groß wie Deutschland ist, Richtung angrenzender Biome entwässert. Dadurch spielt der Cerrado für den Wasserkreislauf der angrenzenden Biome wie der Amazonas-Region und des Pantanals eine sehr wichtige Rolle. Und wie es scheint helfen die Moore, die vor allem in den Quellregionen im Cerrado regelmäßig vorkommen, in der Regenzeit Wasser in der Landschaft zurückzuhalten und zu speichern, das in der Trockenzeit nach und nach in die Flüsse abgegeben wird. Dadurch wird ein konstanter Wasserfluss auch in der mehrmonatigen trockenen Phase garantiert.
Erste Zahlen deuten zudem darauf hin, dass Moore zwar weniger als ein Prozent der Fläche des Cerrado bedecken, in ihrem Boden jedoch über 13% des gesamten Bodenkohlenstoffs des Cerrado speichern, wodurch sie eine enorme Bedeutung auch aus Klimaschutz-Sicht hätten.
Unsere Untersuchungen zur Bedeutung von Mooren sowie von Veredas und Sumpfwäldern auf Torf, sowie die Untersuchungen weniger anderer Forschungsgruppen sind auch deshalb dringend notwendig und wichtig, weil die Naturzerstörung im Cerrado schneller voranschreitet als in der vielbeachteten Amazonas-Region. Vor allem das Agrobusiness, beispielsweise der Soja-Anbau, aber auch Holzplantagen, stören den Wasserkreislauf im Cerrado empfindlich. Sinkende Grundwasserspiegel und austrocknende Feuchtgebiete sind die Folge. Es ist leider kaum erfasst, wie stark und großflächig sich der Zustand der Moore und anderer Feuchtgebiete verschlechtert. Aber wir konnten wirklich überall, wo wir waren, die Folgen von Austrocknung und z. B. Torfbränden – letztendlich das schrittweise Verschwinden der Moore und Feuchtgebiete beobachten.
Ein wichtiger Schritt neben der wissenschaftlichen Arbeit an dem Thema ist aus unserer Sicht die Schaffung eines Bewusstseins in Brasilien für die Existenz von Mooren im Cerrado und ihrer Bedeutung. Denn eigentlich ist der Begriff Moore (portugiesisch – turfeiras) bisher nur einer kleinen Forschungs-Community bekannt, wenn auch die allgemeine Bedeutung von Feuchtgebieten klar ist.
Stay tuned für die ersten wissenschaftlichen Ergebnisse aus unserem Cerrado-Moorforschungsprojekt!

Gut gelaunte Forscher im brasilianischen Moor. Foto: Felix Beer (links im Bild).
Autor: Felix Beer, Greifswald Moor Centrum
Save the Date für RRR2025

Die vierte internationale RRR-Konferenz zum Thema "Renewable Resources from Wet and Rewetted Peatlands" bringt vom 23. bis 26. September 2025 in Greifswald Expert*innen aus verschiedenen Disziplinen zusammen, um Erkenntnisse und Erfahrungen auszutauschen und drängende Fragen der Paludikultur zu erörtern.

Vom 23.- 26. September 2025 veranstaltet das Greifswald Moor Centrum die vierte internationale RRR-Konferenz "Renewable Resources from Wet and Rewetted Peatlands". Sie bringt Expert*innen aus verschiedenen Disziplinen zusammen, um Erkenntnisse und Erfahrungen auszutauschen und drängende Fragen der Paludikultur zu erörtern.
2023 feierte das Konzept „Paludikultur“ das 25-jährige Bestehen. In den Bereichen Wiedervernässung, Anbau, Verarbeitung, Vermarktung, Politikentwicklung und Bewusstseinsbildung gab es in diesem Vierteljahrhundert schon große Fortschritte, aber noch fehlt die Umsetzung in großem Maßstab. Die Konferenz soll die an der Nutzung von wiedervernässten Mooren beteiligten Akteur*innen versammeln. Wissenschaftler*innen, Landbesitzende und -nutzende, Vertreter*innen aus Verwaltung, Produktion und Wirtschaft, sowie Künstler*innen, Designer*innen und politische Entscheidungsträger*innen sind dabei willkommen.
Ein vielfältiges Programm mit Vorträgen, Posterpräsentationen, Exkursionen und eine Reihe von interaktiven Veranstaltungen soll den sinnvollen Dialog dazu ermöglichen und wird derzeit auf die Beine gestellt. Für weitere Infos zu Anmeldung oder dem Einreichen von Abstracts etc. wird auf der Website der Konferenz zu finden sein.
Erste umfassende Klimaeinschätzung der Europäischen Umweltagentur

Die Klimakrise auf 400 Seiten: Die Europäische Umweltagentur (EEA) hat erstmals eine umfassende Einschätzung zum Klima in der EU herausgegeben. Er soll Entscheidungen zur Umwelt- und Klimapolitik in der EU unterstützen. Mit 36 identifizierten Klimarisiken, davon acht mit unmittelbarem Handlungsbedarf, gibt der Bericht einen düsteren Ausblick.
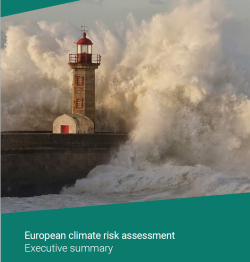
Schlechte Aussichten auch für Moore im European Climate Risk Assessment (EUCRA), der die Klimarisiken erstmals für die gesamte EU zusammenfasst: 50 % der Moorflächen Europas sind degradiert und die Ziele zu ihrer Restaurierung werden meist nicht eingehalten, schätzt der Bericht und beruft sich dabei unter anderem auf wissenschaftliche Veröffentlichungen des Greifswald Moor Centrum. Der Großteil des Schadens ist menschengemacht durch Landnutzung und Trockenlegung. Wegen ansteigender Temperaturen taut in vielen nordeuropäischen Mooren der Permafrost und die Verdunstung nimmt zu. Torfmoose sterben ab, Feuchtgebiete trocknen aus, die Wahrscheinlichkeit für Flächenbrände steigt.
Als eventuellen Lichtblick schließt der Bericht nicht aus, dass sich Moorgebiete bei tauendem Permafrost Richtung Norden ausbreiten. Dabei könnten längere Vegetationsperioden in einigen Mooren die Vegetation verbessern. Durch mehr Pflanzen würde dann auch mehr Kohlendioxid gebunden.
Das EUCRA hat 36 Klimarisiken für Europa identifiziert. Acht davon verlangen sofortiges Handeln und 34 erreichen bei einem weiteren Staus quo voraussichtlich bis Ende des Jahrhunderts kritische und teilweise katastrophale Ausmaße. Besonders Südeuropa gilt als Hotspot für gleich mehrere Klimarisiken durch Wasserknappheit und Hitzewellen.
Neu: Global Wetland Center in Dänemark

Angedockt an der Universität Kopenhagen und unterstützt von der Novo Nordisk Foundation wird ein neues Global Wetland Center zunächst in den nächsten sechs Jahren zur Moorforschung beitragen.

Am Global Wetland Center, offiziell gegründet am World Wetland Day am 2. Februar 2024, wollen Fachleute der Universität Kopenhagen, des Geologischen Dienstes für Dänemark und Grönland und des Dansk Hydraulisk Institut (DHI), einem Softwareentwickler für Modellierungen, daran forschen, wie sich in Mooren und Feuchtgebieten der Ausstoß klimaschädlichen Treibhausgasen mindern lässt. Dafür kommen Modellierungstools, künstliche Intelligenz und Satellitendaten zum Einsatz. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen in Ländern weltweit konkrete Lösungen für ihre individuellen Klimaherausforderungen ermöglichen und politische Entscheider*innen auf dieser Basis Handlungen abstimmen. Sehr gute Kontakte in die Politik trägt Softwareentwickler DHI bei. Seit 1996 arbeitet dieser mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen zusammen. Das UNEP-DHI Centre on Water and Environment ist eine Initiative, um den Umgang mit Süßwasser lokal und global zu verbessern. Das Zentrum berät Länder auf der ganzen Welt, die ihre Wassernutzung nachhaltig gestalten möchten.
MoorMaidens beim Mapathon

Gemeinsam eine Karte von Europas Mooren zu erstellen, war das Ziel eines Open Data Mapathons der University of Galway, der Anfang April 2024 stattfand. Die MoorMaidens suchten als Team des Greifswald Moor Centrum nach frei verfügbaren Daten zur Kartierung von Mooren in Deutschland.
Die University of Galway, Irland, hatte Anfang April zum European Peatlands and Policies Open Data Mapathon geladen. 20 Teams mit 184 Personen waren vor Ort oder nahmen online am Event teil, um Open Source-Daten für 14 europäische Länder zu sammeln, etwa Gesetzestexte und Datensätze zur Kartierung. Jedes Team des Mapathon bearbeitete ein Land, die MoorMaidens hatten sich für Deutschland entschieden. Am 6. April durchforsteten sie das Netz nach GIS-Daten und Gesetzen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene.
Die Ausbeute: Zehn Moor-Datensätze in Form von Shapefiles, darüber hinaus Daten über Landnutzung, Wasser und Organic Carbon Content, sowie zehn Gesetze auf nationaler und regionaler Ebene. Die finale Karte wird derzeit erstellt und ist Ende Juni mit vielen Daten aus dem Mapathon abrufbar.
Mapathon ist übriges kein Schreibfehler, sondern meist ein öffentliches Event - online oder auch im Feld - bei dem Freiwillige helfen, bestehendes Kartenmaterial mit frei zugänglichen Daten zu verbessern. Eine ursprüngliche Idee war zum Beispiel, Risiken für von Katastrophen gefährdete Gebiete zu erfassen. Der Mapathon, organisiert von Projekt WaterLands und University of Galway, arbeitete hauptsächlich mit dem Programm QGIS. Alle Teilnehmenden erhielten im Anschluss die Arbeiten der anderen Teams und profitierten so gemeinsam. Nützlich war der Mapathon natürlich auch als Netzwerkevent.
Ein Projekt vorgestellt
MoorPV

Erneuerbare Energie gewinnen und gleichzeitig zusätzlich Treibhausgasemissionen einsparen – das klingt nach einem Win-win. Ob bei Photovoltaik auf wiedervernässten Flächen Energiewirtschaft wie Natur gleichermaßen und ohne Nebenwirkungen profitieren, untersucht das neue Projekt MoorPV an der Universität Greifswald.

Wie viele Treibhausgase stößt eine wiedervernässte und für Photovoltaik genutzte Moorfläche aus? Wie entwickelt sich die Biodiversität dort? Wie sieht es mit der ökonomischen Seite aus? Diese Fragen untersucht das Anfang 2024 gestartete Projekt MoorPV in einer dreijährigen Laufzeit. Die hauptsächlich betrachtete Fläche liegt in Schleswig-Holstein. Es handelt sich um stark degradierten, landwirtschaftlich genutzten Boden. Zunächst wird das Wasser auf ein torferhaltendes Niveau in Flurhöhe angestaut und die PV-Anlage installiert. Seit März werden bereits Daten erhoben.
Gemessen werden jeweils unter und neben den Photovoltaikmodulen Kohlendioxid, Methan und Lachgas. Untersucht wird auch, ob die Paneele durch ihren Schatten Verdunstung minimieren und damit hohe Wasserstände im Torfkörper positiv beeinflussen. Denkbar wäre auch, dass Beschattung auch negativ auf Pflanzenwachstum und CO2-Aufnahme auswirkt.
Wie sich die Biodiversität im renaturierten Gebiet entwickelt, gehört auch zu den Untersuchungen im Projekt. Pflanzen, Laufkäfer, Spinnen, Amphibien, Grillen, Fledermäuse und Vögel werden hierfür berücksichtigt. Die ökonomischen Analysen klären u.a. ob Anlagen auf Moorboden teurer sind als auf mineralischem Untergrund und wo mögliche Kosten einzusparen wären.
Am Projekt sind verschiedene Fakultäten der Universität Greifswald beteiligt. Es läuft bis Ende 2026 und wird von der Joachim-Herz-Stiftung gefördert.

Photovoltaikmodule auf der Versuchsfläche Lottdorf (Foto: Monika Hohlbein).
Neuigkeiten aus Paludikultur-Projekten
Schnell wachsende Nachfrage nach Paludikultur - jetzt!

14 namhafte Unternehmen wollen Biomasse von wiedervernässten Flächen in ihre Produktion integrieren und haben sich dafür in der PaludiAllianz zusammengeschlossen. Das Ziel: die Abnehmer-Seite am Markt für Paludikultur stärken und zeigen, dass nasse Bewirtschaftung im großen Stil wirtschaftlich sein kann.
Ende April, aber Beginn für die Allianz der Pioniere: 14 große Wirtschaftsunternehmen aus der Papier-, Verpackungs-, Bau-, Dämmstoff- und Holzwerkstoffindustrie erklärten mit einer Auftaktveranstaltung in Berlin, nachwachsende, regionale Rohstoffe von nassen Moorflächen in ihrer Produktion zu testen und möglichst zu integrieren. Eine schnell wachsende Nachfrage nach Paludikultur in verschiedenen Wirtschaftssektoren sei jetzt das Ziel, so die Pressemitteilung der Umweltstiftung Michael Otto und der Succow Stiftung, Partner im Greifswald Moor Centrum. Sie haben die PaludiAllianz in der gemeinsamen Initiative toMOOROw ins Leben gerufen. Zu den Gründungsmitgliedern zählt nun namhafte Unternehmen:
Interesse an zukünftigen Paludikulturprodukten im Bausektor haben der Fertighaushersteller Bau-Fritz GmbH & Co. KG, der Baukonzern STRABAG SE und die OTTO WULFF Bauunternehmung GmbH und die auf Gebäudebeschichtung spezialisierte Sto SE & Co. KGaA. Die Unternehmen toom Baumarkt und OBI Group Holding SE & Co. KGaA beachten Biomasse von vernässten Flächen zudem im Segment Gartenbau als Anbieter von Substraten.
Papier und Verpackungen durch einen Anteil an Paludikultur-Biomasse nachhaltiger zu machen, dafür engagieren sich das Handels- und Dienstleistungsunternehmen Otto (GmbH & Co. KG), die LEIPA Group GmbH, die WEPA Stiftung sowie im Bereich Wertstoffmanagement PreZero Stiftung & Co. KG mit OutNature GmbH. Im Bereich der Konsumgüter für Haushalt und Kosmetik beteiligt sich Procter & Gamble Service GmbH, sowie im Bereich Einzelhandel Tengelmann Twenty-One KG mit KiK Textilien und Non-Food.
„Aufbau von skalierbaren Wertschöpfungsketten mit Paludikultur-Biomasse aus wiedervernässten Mooren in Deutschland in praktischer Zusammenarbeit mit Wirtschaftsakteuren“ (PaludiAllianz) lautet der ausführliche Titel des Projektes, für das Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir an diesem 30. April in der Berliner Kulturbrauerei einen Förderbescheid in Höhe von knapp 1,8 Millionen Euro über die kommenden drei Jahre übergab. Da Wiedervernässungen gleichzeitig effektiven natürlichen Klimaschutz bieten, war auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke war Gastrednerin der Veranstaltung.
BLuMo - Wasser ist der Schlüssel

750 Hektar groß ist die Demonstrationsfläche im BLuMo-Projekt in Brandenburg. Das Landesamt für Umwelt Brandenburg und das Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. erproben darauf Paludikultur und wollen die gewonnenen Rohstoffe zu sinnvollen Produkten verarbeiten lassen.

BLuMo steht für „Brandenburgs Luchgebiete klimaschonend bewahren – Initiierung einer moorerhaltenden Stauhaltung und Bewirtschaftung“ (BLuMo). Ziel des 2021 gestarteten Projektes ist, den Wasserstand in Moorböden auf 750 Hektar Demonstrationsflächen im Rhinluch, im Randowbruch und in den Möllmer Seewiesen wieder anzuheben und dabei die Bewirtschaftung in Paludikultur zu erproben.
Das ist nicht nur hinsichtlich des Klimaschutzes von Vorteil. Trotz vieler Gewässer gehört Brandenburg zu den trockensten und niederschlagsärmsten Bundesländern in Deutschland. Auch hier steigen die Temperaturen. Mehr Wasser verdunstet und fehlt zum Auffüllen der Grundwasserspeicher. Zugleich begünstigt der Klimawandel länger anhaltende Wetterlagen wie Regen- oder Dürreperioden.
Für einen ausgleichenden Einfluss auf den Landschaftswasserhaushalt will das BLuMo-Projekt auf den Demonstrationsflächen wieder mehr Wasser zurückhalten und speichern, und so bei zunehmend längeren Hitzeperioden das Austrocknen der Landschaft insgesamt verhindern. Daneben erprobt BLuMo gemeinsam und in Absprache mit Landwirt*innen die Bewirtschaftung in Paludikultur. Der Kooperationspartner im BLuMo-Projekt, das Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB) forscht an landwirtschaftlichen Verfahrensketten und innovativen Lösungen für die wirtschaftliche stoffliche Verwertung von Moorbiomasse sowie am Aufbau nachhaltiger regionaler Wertschöpfungsketten. Konkret bedeutet dies: Untersuchungen zu torffreien Pflanzerden, Begrünungssubstraten sowie Versuche zu faserbasierten Werkstoffplatten und Pellets als Einstreumaterial für biologische Landwirtschaft. Außerdem arbeitet das ATB zum Einsatz der Biomasse in Papieren und Formteilen. Diese Verwendung reduziert den ökologischen Fußabdruck durch einen geringeren Wasser-, Energie- und Holzverbrauch. Bisher entwickelte Produkte haben unterschiedliche Stufen der Praxisreife und weiteren Bedarf an wissenschaftlicher Erforschung.
Moore, Emissionen und Moorpolitik in Brandenburg
Brandenburg hat insgesamt 264.000 Hektar Moor- und Moorfolgebodenfläche und ist damit nach Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern das Bundesland mit dem drittgrößten Flächenanteil an organischen Böden. Das sind knapp zehn Prozent der Landesfläche und entspricht in der Größe etwa dem Saarland.Im Nordosten Deutschlands werden Moore landläufig als Luch bezeichnet. Es gibt dort eine große Vielfalt an unterschiedlichen Moortypen. Heutzutage sind nur noch 3 % der Moore in Brandenburg in naturnahem Zustand, meist wurden sie für landwirtschaftliche Zwecke entwässert mit der Folge, dass Brandenburger Moore mehr Kohlendioxid emittieren als der gesamte Verkehrssektor des Bundeslandes.
Die Politik hat die Relevanz der Moore für den Klimaschutz und einen ausgeglichenen Landschaftswasserhaushalt erkannt. Das Land Brandenburg hat im März 2023 ein Moorschutzprogramm verabschiedet. Das Programm greift die Bund-Länder-Zielvereinbarung Klimaschutz durch Moorbodenschutz auf. Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen aus Moorböden in Brandenburg um 750.000 Tonnen CO2-Äquivalente sinken. Dazu fördert die Bundesregierung insgesamt neun Pilot-und Demonstrationsvorhaben in Deutschland. BLuMo, eines der beiden in Brandenburg geförderten Projekte mit einer Laufzeit bis Ende 2031, wird vom Landesamt für Umwelt Brandenburg geleitet und vom Bundesministerium für Umwelt, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz gefördert.
Autorin: Bettina Tacke, Landesamt für Umwelt Brandenburg
MoorAgentur MV: Moore schützen, Paludikultur fördern

Bundesweit bisher einmalig ist die am 2. Mai eröffnete MoorAgentur in Mecklenburg-Vorpommern. Finanziert vom Umweltministerium und getragen von der Landgesellschaft M-V soll die MoorAgentur bei der Umsetzung von Wiedervernässung und Paludikultur unterstützen.
Das Thema Paludikultur ist für die meisten konventionellen Landwirt*innen neu und gewagt. Investitionen scheinen hoch, Erträge unsicher, Erfahrungen fehlen ebenso wie starke Wertschöpfungsketten für Produkte aus Paludikultur. Dabei kann Paludikultur eine Chance sein - für Umwelt und betreffende Akteur*innen.
Interessierten Landwirt*innen einen Einstieg zu erleichtern, ist die Aufgabe der neuen MoorAgentur MV. Sie beantwortet Fragen zu Fördergeldern, berät zur Umstellung und Genehmigungsverfahren, vernetzt und hilft mit Kontakten weiter. Die Agentur sieht sich als Schnittstelle zwischen Praxis, Verwaltung und Wissenschaft und möchte aktiv bei der Planung und Umsetzung von Moorschutzmaßnahmen helfen.
Sanieren und modernisieren ...
... mit Holz und anderen nachwachsenden Rohstoffen, z. B. aus Paludikultur - dafür gibt es bis Ende Juli die Möglichkeit, eine Förderung der Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe (FNR) zu ergattern. Projekte aus den Bereichen Forschung und Entwicklung werden ebenso gefördert wie Modellvorhaben.
Viele Gebäude in Deutschland müssen nach neuestem Standard saniert werden, wenn die Bundesrepublik ihre Klimaziele einhalten möchte. Etwa 41 % der Treibhausgasemissionen entstehen durch den Bau und den Betrieb von Gebäuden. Werden sie modernisiert, stehen die Chancen gut, es bis 2045 zu schaffen mit der Klimaneutralität. Der Aufruf hat das Ziel, die klimafreundliche Sanierung mit nachwachsenden Rohstoffen, unter anderem aus Paludikultur, zu fördern. Wichtig ist den Geldgebern, dass die verwendeten Produkte am Ende ihres Lebenszyklus gut recyclebar sind und dass sie einfach und kostengünstig für den Anwender umgesetzt werden können.
Aussicht auf eine Förderung haben Forschungs- und Entwicklungsprojekte, aber auch Modellvorhaben. Projektvorschläge müssen bis zum 31. Juli 2024 bei der FNR eingegangen sein. Weitere Informationen zu den Fördermöglichkeiten finden Sie hier.
Veranstaltungen
Alle aktuellen Veranstaltungen sind in unserem Online-Kalender zusammengestellt.
Publikationen
Literatur:
Adriani, D., Yazid, M., Riswani, Damayanthy, D., Choi, E., Yang, H. 2024: Livelihood Alternatives in Restored Peatland Areas in South Sumatra Province, Indonesia. Land, 13, 643. DOI: 10.3390/land13050643
Eickenscheidt, T., Bockermann, C., Bodenmüller, D., Großkinsky, T., Gutermuth, S., Hafner, M., Hartmann, H., Hartung, C., Heuwinkel, H., Kapfer, M., Krimmer, J., Krus, M., Kuchler, C., Kuptz, D., Lohr, D., Mack, R., Mäck, U., Mann, S., Meinken, E., Moning, C., Rist, E., Schön, C., Schröder, T., Schumann, A., Theuerkorn, W., Zollfrank, C., & Drösler, M. 2023: MOORuse - Paludikulturen für Niedermoorböden in Bayern - Etablierung, Klimarelevanz & Umwelteffekte, Verwertungsmöglichkeiten und Wirtschaftlichkeit, Abschlussbericht, 254 p. DOI: 10.5281/zenodo.10778063.
Hammerich, J., Schulz, C., Probst, R., Lüdicke, T., & Luthardt, V. 2024: Carbon content and other soil properties of near-surface peats before and after peatland restoration. PeerJ. Apr 18;12. DOI: 10.7717/peerj.17113
Heindorf, C., Schüler, S., & Plieninger, T. 2024: Poetic inquiry to explore the relational values of a transforming peat landscape. People and Nature, 00, 1–17. DOI: 10.1002/pan3.10629
Mander, Ü., Espenberg, M., Melling, L., Kull,, A. 2024: Peatland restoration pathways to mitigate greenhouse gas emissions and retain peat carbon. Biogeochemistry 167, 523–543. DOI: 10.1007/s10533-023-01103-1
Wichmann, S., Nordt, A. 2024: Unlocking the potential of peatlands and paludiculture to achieve Germany’s climate targets: obstacles and major fields of action. Frontiers in Climate 6, 1380625: 1-20. DOI: 10.3389/fclim.2024.1380625









