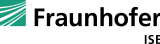MoorPower
Nachhaltige und innovative Photovoltaik-Lösungen für wiedervernässte Moorböden
Hintergrund
Die Wiedervernässung trockengelegter Moorböden ist die effektivste Maßnahme, um die aus ihnen entstehenden Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren. Die Kombination von Photovoltaik-Anlagen (PV) und Wiedervernässung könnte eine ökonomisch attraktive Nutzungsform für diese Flächen sein.
Bisher gibt es noch kein Projekt, welches die Wiedervernässung von Moorböden und die Nutzung dieser durch PV-Freiflächenanlagen (PV-FFA) von Beginn an zusammen geplant hat. Allerdings waren bundesweit 2022 schon über 500 ha entwässerter Moorboden durch PV-FFA bebaut. Mit dem novellierten Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wurde 2023 erstmals die Errichtung von Photovoltaik auf Moorböden gesondert betrachtet: Es wurden „Besondere Solaranlagen“ eingeführt, worunter Anlagen auf Moorböden zählen, die entwässert und landwirtschaftlich genutzt worden sind, wenn die Flächen mit der Errichtung der Solaranlage dauerhaft wiedervernässt werden. Die Bundesnetzagentur hat die Anforderung an PV-FFA auf wiedervernässten Moor- und weiteren organischen Böden („Moor-PV“) zum 01.07.2023 erstmalig festgelegt und auch die Möglichkeit einer zusätzlichen landwirtschaftlichen Flächennutzung durch Paludikultur („Paludi-PV“ als Variante von „Moor-PV“) geregelt. Aktuell ist das Interesse an Moor-PV bei Landwirt*innen und PV-Entwickler*innen sehr hoch.
Ziele des Projekts
- erstmalige umfassende Untersuchung der technischen, ökologischen und sozio-ökonomischen Effekte und juristischen Fragen der Kombination von Moor-Wiedervernässung und Photovoltaik in Kombination mit Bewirtschaftung der Fläche mit Paludikulturen
- Ableitung von Handlungsempfehlungen für die konkrete Umsetzung von Moor-/Paludi-PV in Deutschland
Hierzu wird ein stratifiziertes Konzept von kleinskaligen Kausalanalysen über mesoskalige Manipulationsexperimente bis hin zur Begleitforschung von Umsetzungsflächen auf Landschaftsebene verfolgt:
Auf einer Materialtestfläche (Baden-Württemberg) werden die Effekte verschiedener Materialien und Fundamentierungsoptionen kleinflächig etabliert. Dabei werden die Auswirkungen des Moores auf die eingesetzten Materialien und Installationen, aber auch der Einfluss der eingesetzten Materialien auf Wasserqualität, Bodenphysik und Mikrobiom betrachtet.
Um die bestmögliche Verbindung von ökonomischen und ökologischen Aspekten zu eruieren, werden verschiedene Installationsweisen der PV-Anlage (Aufständerungshöhe, Modultypen mit verschiedenen Verschattungsgraden, Fundamentierung) in einer Experimentalanlage (Mecklenburg-Vorpommern) direkt verglichen. Hier werden Freiflächen-PV und Wiedervernässung sowie Paludikultur parallel geplant. Diese Fläche ist gleichzeitig das realitätsnahe Forschungsobjekt für Akzeptanzforschung und juristische Fragestellungen. Außerdem soll diese Experimentalfläche als offene Forschungsplattform allen Wissenschaftler*innen auch außerhalb dieses Verbundes zur Verfügung stehen und gleichzeitig ein wichtiges Anschauungsobjekt für Wissenschaftskommunikation darstellen.
Auf einer größeren Umsetzungsfläche (Niedersachsen) wird die Gesamttreibhausgasbilanz ermittelt. Hier können keine experimentellen Varianten von PV mehr betrachtet werden, aber neben den landschaftsskaligen ökologischen Effekten auch die realistischen ökonomischen und juristischen Aspekte, welche ähnlich für alle zukünftigen Umsetzungsprojekte zu erwarten sind.
Neben Ökonomie und Klimaschutz wird dabei explizit auch die Entwicklung der Biodiversität nach Anlageninstallation und Wiedervernässung untersucht, um das Potenzial von Moor-/ Paludi-PV für Naturschutzziele zu evaluieren. Die Forschungsflächen sind typische Moorflächen und über die Betrachtungen entlang interner Gradienten im Wasserstand werden die Ergebnisse für alle wiederzuvernässenden Moorflächen in Deutschland von Relevanz sein.
Die oben beschriebenen Forschungsergebnisse werden dringend benötigt, um PV-Anlagen auf Moorböden zu bewerten, mögliche negative Auswirkungen der Anlagen zu identifizieren und diese z. B. durch fachliche Leitplanken und Genehmigungsvorgaben zu vermeiden bzw. bestehende Anlagen entsprechend anzupassen.
Arbeitspakete
Das Arbeitspaket widmet sich dem Arbeitsprozess von der Planung bis zur Errichtung einer PV-Anlage auf einer Moorfläche sowie der Optimierung dieses Prozesses im Kontext Moor. Dafür werden Lichtsimulationen und Materialtests durchgeführt sowie alte und neue Erkenntnisse dokumentiert.
Das Arbeitspaket beinhaltet die kontinuierliche, wissenschaftliche Begleitung der Paludi-PV-Anlagen auf der Experimentalfläche sowie die Optimierung des Anlagenbetriebs, wobei sich nicht auf die PV-Leistung beschränkt wird, sondern auch die Ergebnisse aus AP 3-7 mit einbezogen werden.
Zuerst finden Flächenauswahl für die drei Teilflächen der Experimentalanlage innerhalb des gesamten, extern geplanten Maßnahmengebiet und gebietsspezifische Abstimmungen mit allen einzubindenden Personen (Eigentümer*innen aller Teil- und betroffenen Nachbarflächen) statt. Für die Gesamtfläche wird ein gemeinsames, Synergien nutzendes Konzept für Wiedervernässung, PV (und ggf. Paludikultur) entwickelt, in dem die notwendigen Maßnahmen aufeinander abgestimmt sind, um Eingriffe so gering wie möglich zu halten. Dafür werden – je nach Fläche – noch fehlende Planungsschritte (z.B. artenschutzrechtliche Fachbeiträge) erarbeitet. Das Genehmigungsverfahren für die Wiedervernässung muss parallel zu Genehmigung/Bau der PV-Anlage erfolgen; daran schließt sich die Beauftragung der Umsetzung der Wiedervernässung (nach Bau PV-Anlage). Dabei erfolgt eine enge Abstimmung mit den involvierten Partnern aus AP 1 und AP 2 (Betreiber, Errichter und ISE) für die Belange der PV-Forschung. AP3 unterstützt hier die Wiedervernässungsplanung- und umsetzung auf der Gesamtmaßnahmenfläche, fokussiert aber dabei vor allem auf die Optimierung der Wasserstände für die drei Teilflächen der Experimentalanlage. Je nach Erfolg der Gesamtmaßnahme erwarten wir hier den Bedarf von Nachjustierungen auf Teilflächenebene auch noch während und nach dem ersten Jahr der Gesamtwiedervernässung.
Das AP zielt auf die Quantifizierung des Wasserhaushaltes der Experimentalanlage unter Einbeziehung aller relevanten hydrologischen Komponenten. Auf der Umsetzungsfläche werden Mikroklima, Bodenhydrologie und Verdunstung quantifiziert. Darauf basierend werden physikalische, hydrochemische und geochemische Qualität relevanter Systemkompartimente (Grundwasser, Moorwasser, Torf) charakterisiert, hydrogeochemische Prozesse und Flüsse identifiziert und die Konsequenzen für zukünftige Entwicklungen bewertet.
In diesem AP soll erstmals der THG-Austausch einer Moor-PV-Anlage mittels Eddy-Kovarianz bestimmt werden. Die Eddy-Kovarianz-Methode integriert über den gesamten Standort, so dass damit keine Aussagen zu kleinräumigen Unterschieden in z.B. Wasserständen, Beschattung oder anderen natürlichen oder technischen Gegebenheiten getroffen werden können. Aus diesem Grund werden auf der Experimentalfläche THG-Messungen mit manuellen Hauben durchgeführt. Daneben sollen ausgewählte Untersuchungsvarianten in das deutschlandweite Moorbodenmonitoring integriert werden, so dass ein Vergleich von Bodeneigenschaften und Bodenbewegung (mittel- bis langfristiger Proxy für Änderungen der Kohlenstoffvorräte, Indikator für Bodenverdichtung) mit einer weiten Bandbreite von Standorten in ganz Deutschland möglich ist.
Torfbildung erfolgt, wenn pflanzlicher Biomasseaufbau den Abbau übersteigt. Gerade für Niedermoore ist dabei die unterirdische Biomasse entscheidend. Neben den Effekten von Paludi-PV auf die Biomasse sollen hier auch mögliche Veränderungen in der Phytodiversität untersucht werden. Im Fokus stehen dabei moortypische Arten, welche oft wegen des starken Habitatverlustes gefährdet sind. Auf der Experimentalanlage werden dabei verschiedene Varianten der Installation direkt miteinander verglichen (Aufständerungshöhe, Fundamentierung, Modultypen) und so die bestmögliche Variante ermittelbar. Die Nutzung der oberirdischen Biomasse in Paludikultur im Vergleich zu Nicht-Nutzung als Moor-PV wird hier mit einbezogen, da sie massiv in die Konkurrenzverhältnisse in der Vegetation eingreift und deshalb erwartbare Auswirkungen haben kann. Die Anlage über einen Gradienten von Wasserständen hinweg erlaubt darüber hinaus eine höhere Verallgemeinerung der Ergebnisse. Biomasseaufbau wird mittels Ingrowth-cores (unterirdisch) und wiederholter destruktiver Ernte (oberirdisch) quantifiziert, der Abbau mittels Litterbags. Die Phytodiversität wird per Plot-basierten wiederholten Vegetationsaufnahmen erfasst.
Wir erwarten, dass Paludi-PV Anlagen vor allem über die Effekte von Verschattung auf die Vegetationszusammensetzung, den Biomasseaufbau und die Torfbildung wirken. Derartige Untersuchungen zu Moorflächen fehlen bislang komplett. Deshalb wird dieser Aspekt über die Freilandstudien hinaus dezidiert kausalanalytisch in kontrollierten Topf- und Mesokosmen-Experimenten betrachtet. Die Mischung aus Freilanduntersuchungen und Experimenten in Gefäßen, die in diesem Arbeitspaket durchgeführt werden, werden demnach wichtige, bislang noch nicht verfügbare Ergebnisse zu dem Effekt von PV-Anlagen in Moorflächen liefern. Betrachtet werden dabei besonders die Kohlenstoffakquise der unterschiedlichen Pflanzen, ihre Wassernutzungseffizienz, ihr Biomasseaufbau (ober- und unterirdisch) und die potentielle Torfbildung. Die Ergebnisse zur Wassernutzungseffizienz und zur Torfbildung werden mit den Daten für eine gesamte Anlage (AP5) abgeglichen.
Im Rahmen des AP werden diverse Gruppen ökologisch relevanter Mikroorganismen (Bakterien, Archaeen, Pilze, Protisten) und Gliederfüßer (insbesondere Laufkäfer und Spinnen) auf der Experimentalfläche untersucht. Ein wesentlicher erster Schritt ist dabei die Erfassung des Ausgangszustandes der Biodiversität im ersten Projektjahr. Daher erfolgen die ersten Probennahmen auf der Experimentalfläche bereits vor Installation der Anlagen. Die Untersuchungen der Organismen des Bodens und der Bodenoberfläche verlaufen parallel. Die Messung der Sukzession und jahreszeitlichen Dynamik der Biodiversität erfolgt im zweiten und dritten Projektjahr. Das vierte Projektjahr dient der integrativen Analyse der Biodiversität. Dadurch werden mögliche Beziehungen und Einflüsse des Bodenbioms auf die Biodiversität der Organismen auf der Bodenoberfläche aufgedeckt. Zusätzlich werden Ergebnisse des Projekts „RoVer“ zu faunistischen Untersuchungen am Standort Großes Bruch (Vögel, Libellen, Fledermäuse) in die Gesamtauswertung einbezogen und nach Möglichkeit weitergeführt. Außerdem werden die Gründungsvarianten auf der Materialtestfläche durch Untersuchungen des Mikrobioms begleitet.
Moor-PV bietet die Möglichkeit die Wiedervernässung von trockengelegten Moorflächen mit der deckungsbeitragstarken Flächennutzungsmöglichkeit der Photovoltaik zu kombinieren. Wie Erfahrungen aus anderen Erneuerbaren Energien (Windkraft, Bio-Gas, Solarparks) gezeigt haben, spielt die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung (soziopolitische Akzeptanz), aber auch bei den beteiligten und betroffenen Stakeholdern (Marktakzeptanz und Akzeptanz vor Ort) eine entscheidende Rolle für den Markthochlauf einer solchen Kombination. Erkenntnisse und Erfahrungen mit anderen erneuerbaren Energien sind deshalb systematisch auszuwerten. Hierbei werden Ansätze und Ergebnisse aus dem Projekt RoVer (Thünen-Institut) berücksichtigt.
Ausgehend von den Pilotanlagen werden in AP 8 die ökonomischen und sozialen Auswirkungen von unterschiedlichen Moor-PV Anlagen in unterschiedlichen räumlichen, sozialen und Landschaftskontexten ermittelt und mit Untersuchungen zur sozialen Akzeptanz verknüpft. In einem geeigneten Fallstudiendesign kommen sowohl qualitative als auch quantitative Methoden der empirischen Sozialforschung zum Einsatz, um Einflussfaktoren der sozialen Akzeptanz in den Dimensionen der sozialpolitischen Akzeptanz, der Marktakzeptanz und der Akzeptanz vor Ort zu bestimmen. Wahlexperimente werden durchgeführt, um gezielt den Einfluss von ausgewählten Faktoren zu untersuchen.
In diesem AP findet die rechtliche Begleitung der Projektpartner bei der Anlagenkonzeption und die Begleitung der Planungs- und Genehmigungsbehörden bei der Durchführung der entsprechenden Verfahren statt. Es wird ein anwendungsorientierter Leitfaden für Kommunen und Genehmigungsbehörden mit Elementen einer effizienten Verfahrensgestaltung entwickelt. Eine Datenbank der Inhalts- und Nebenstimmungen bei Moor-PV-Anlagen mit Empfehlungen für die Best-practise-Anwendung wird aufgebaut.
Aufbauend auf erfolgreich durchgeführte bundesweite Vernetzungsprojekte der Projektpartner zum Thema Moorschutz und Agri-PV wird gemeinsam mit dem assoziierten Partner KNE ein bundesweites Netzwerk zu MoorPV aufgebaut. Über virtuelle Formate werden Informationen und Anregungen zum Co-Design der Forschung in den Verbund aufgenommen und Wissen der Projektpartner mit den Beteiligten geteilt. Im Arbeitspaket werden zielgruppengerechte Publikationen erarbeitet und über die Netzwerke der Projektpartner breit geteilt. Neu entstandenes Wissen wird in die Lehr- und Weiterbildungsaktivitäten der Verbundpartner eingebaut und Dritten zur Verfügung gestellt. Erkenntnisse werden in die laufende Politikberatung eingebaut.
Die Projektkoordination gewährleistet den planmäßigen Ablauf des transdisziplinären Verbundprojektes, verantwortet die Kommunikation mit Projektträger, unter allen beteiligten Partnern und mit Auftragnehmern soweit nicht explizit in anderen APs abgedeckt. Sie koordiniert die gemeinsame Datenerhebung auf den Forschungsflächen und sorgt für den zielgerichteten Austausch zwischen den Partnern, so dass die Forschungsdaten maximal zusammenpassen und sich die Forschungsaktivitäten synergetisch ergänzen und nicht behindern (räumliche und zeitliche Beprobungspläne und kontinuierliche Messung von Umweltparametern). Die Koordination baut den Kontakt zu ähnlichen Projekten weltweit auf und unterstützt aktiv externe Forschende auf den MoorPower-Flächen, um so weitere komplementäre Forschung zu ermöglichen. Die Koordination hält weiterhin den Kontakt zum wissenschaftlichen Beirat, informiert diesen über Fortschritt und Veränderungen im Verbund und organisiert den regelmäßigen Austausch mit dem Beirat.
Partner
Partner innerhalb der Universität Greifswald:
- Institut für Botanik und Landschaftsökologie, AG Moorforschung
- Institut für Botanik und Landschaftsökologie, Lehrstuhl für AVWL und Landschaftsökonomie
- Institut für Mikrobiologie, Abteilung Bakterielle Physiologie
- Institut für Geographie und Geologie, Lehrstuhl für Angewandte Geologie
- Zoologisches Institut und Museum, Zoologisches Museum
- Institut für Energie-, Umwelt- und Seerecht (IfEUS), Lehrstuhl für Öffentliches Rechts, insb. Verwaltungs- und Umweltrecht
Partner extern:
- Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Moor-Photovoltaik
- Universität Hohenheim, Institut für Landschafts- und Pflanzenökologie, Fachgruppe Pflanzenökologie
- Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei, Thünen-Institut für Agrarklimaschutz
- Praxispartner